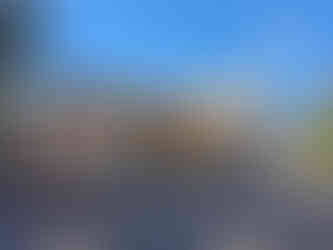ZEICHENFESTIVAL: DENKEN MIT DEM STIFT
- 11. Nov. 2025
- 7 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 8. Jan.
Beim Oldenburger Zeichenfestival wird nicht nur gezeichnet – hier wird gedacht, geforscht, reflektiert. Seit rund 20 Jahren bringt das Festival Jugendliche zusammen, die sich eine Woche lang mit einem gesellschaftlich relevanten Thema künstlerisch auseinandersetzen. Heraus kommen Arbeiten, die berühren, überraschen und manchmal auch provozieren. Anlässlich des 10. Zeichenfestivals im Herbst 2025 haben wir mit Festivalleiter Georg Lisek gesprochen – über künstlerische Freiheit, Vertrauen und die Kraft, sich selbst zu begegnen.

Ortstermin in der Oldenburger Kunstschule in der Weskampstraße. Zum Zeitpunkt unseres morgendlichen Besuchs sind die Gänge und Räume im ehemaligen Handwerksbetrieb still und leer. Dennoch verströmen sie eine spezielle Aura, um nicht zu sagen: Magie. Dass hier Kunst gedacht, gelernt und geschaffen wird, ist überall zu sehen und zu spüren - etwa anhand der zahlreichen Staffeleien oder der bunt befleckten Tische in jeder Höhe und Größe. Am liebsten würde man selbst loslegen, so stark ist die Wirkung.
Doch wir haben anderes zu tun. Denn inmitten dieses Szenarios wartet Georg Lisek. Der gebürtige Berliner ist selbst Bildender Künstler und kam 2019 zunächst nur für die Leitung des 7. Zeichenfestivals nach Oldenburg. Obwohl er seinerzeit in Dresden zuhause war und Lehrbeauftragter an der dortigen Hochschule für Bildende Künste war, konnte Oldenburg ihn überzeugen. Einige Jahre später zog Gerog von der Elbe an der Hunte und hatte für das Zeichenfestival viele neue Ideen im Gepäck. Welche davon er bereits umsetzen konnte, was er hingegen unangetastet gelassen hat und was das Festivals aus seiner Sicht wichtig macht? Das hat er uns im Interview verraten.

Georg, du warst nicht von Anfang an beim Projekt dabei, kennst dich aber inzwischen ziemlich gut aus. Kannst du kurz erzählen, worum es in diesem Format geht?
Das Zeichenfestival wurde vor rund 20 Jahren gegründet. Es entstand aus dem Wunsch heraus, Jugendliche stärker für die Kunstschule zu begeistern – nicht im klassischen Kursformat, sondern als Festival. Viele Kunst- und Musikschulen haben das Problem, dass Jugendliche sich in der Pubertät zurückziehen. Wir wollten das ändern und sind mit Projekten direkt an Schulen gegangen, haben Workshops entwickelt, die kürzer und thematisch konzentrierter sind. So entstanden über die Jahre Formate wie „Zeichnen und Bewegung“ oder „Schwarmzeichnen“. Zuletzt ging es 2023 unter dem Titel “Zeichnen und Zombies“ ums Anderssein und 2025 bei „Zeichnung und Sex“ um das Spannungsverhältnis von Körper und Gesellschaft.
Wenn man „Festival“ hört, denkt man sofort an Bühnen, Musik, Publikum. Die gibt es bei euch alles nicht. Warum ist die Bezeichnung trotzdem richtig?
Ich habe selbst lange gebraucht, um zu verstehen, wie Zeichnen und Festival zusammenpassen. Für mich war ein Festival immer etwas Lautes, Gemeinschaftliches, fast Rauschhaftes. Und tatsächlich hat das Zeichenfestival auch etwas davon – aber eben auf eine stille, konzentrierte Art. Rund 150 bis 200 Jugendliche arbeiten eine Woche lang gemeinsam an einem Thema.
Sie tauchen richtig ein, verlieren das Zeitgefühl, merken, dass Kunst machen Arbeit ist, ernsthafte Auseinandersetzung. Und am Ende entsteht etwas, das sie so noch nie erlebt haben.
Still und konzentriert: Statt Bands und Bühnen begegnen die Teilnehmenden des Oldenburger Zeichenfestivals vor allem sich selbst. (Bilder: Izabela Mittwollen)
Findet das Festival eigentlich an einem festen Ort statt oder wechselt ihr die Locations?
Es findet an ganz unterschiedlichen Orten statt. Wir arbeiten in den Räumen der Kunstschule, aber auch an Orten, die wir speziell für die Workshops aussuchen. Einmal haben Jugendliche Animationsfilme gemacht – dafür haben wir eine Tiefgarage genutzt. Da war es stockdunkel, kein Tageslicht, und sie haben sich eine Woche lang komplett in ihre Arbeit vertieft. In diesem Jahr waren wir unter anderem im Prinzenpalais am Damm.
Gibt es ein Erlebnis, das für dich besonders typisch für das Festival ist?
Ja, viele Jugendliche merken hier, dass Zeichnen nicht einfach nur „ein hübsches Bild malen“ bedeutet. Es ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem Thema, mit Kunst überhaupt. Dieses Jahr ging es um „Sex, Körper und Gesellschaft“. Einige 15-Jährige haben am Ende Selbstporträts gemacht, teilweise abstrahiert, teilweise nackt – so, wie sie sich selbst wahrnehmen. Das fand ich unglaublich stark. Ich hätte mich in dem Alter nie so geöffnet. Das Festival schafft es, Jugendliche in eine intensive Arbeit hineinzubringen, in der sie sich selbst neu begegnen.
Sich selbst neu begegnen: Im Alltag passiert so etwas ja eher selten.
Genau. Beim Festival kommen Dinge zur Sprache – oder zum Ausdruck –, die man sonst nie sehen würde. Ich sage oft: Durch das Zeichnen schauen wir den Jugendlichen in die Köpfe. Die Zeichnungen zeigen Themen, die sprachlich gar nicht so leicht zu fassen wären. Gerade beim Thema Sexualität war das sehr deutlich. Aber egal ob Sex, Bewegung oder Aggression – durch die Zeichnungen werden Diskurse sichtbar. Wir sehen Genderfragen, Körperbilder, gesellschaftliche Haltungen – alles in Linien, Formen, Farben.
Du deutest es an: Eure Themen sind also oft gesellschaftlich relevant. Ist das eine bewusste Entscheidung?
Anfangs war das gar nicht so geplant, das hat sich ergeben. Früher dachte ich, man müsse vorsichtig sein mit solchen Themen. Heute denke ich das Gegenteil: Wir dürfen nicht vorsichtig sein. Kunst kann Wut, Gewalt, Sexualität, Krieg oder Frieden thematisieren – und sie muss es sogar. Das gibt uns eine Verantwortung. Und es macht Mut, immer wieder neue, schwierige Themen anzupacken.
Die Jugendlichen sprechen dabei nie direkt aus persönlicher Erfahrung, sondern über Stellvertreter, über Symbole. Das schafft Distanz und erlaubt trotzdem Tiefe.
In einer Kunstschule geht es also nicht nur um Technik, sondern auch ums Denken?
Ja, absolut. Es gibt den Satz: „Ich zeichne, also denke ich.“ Man könnte auch sagen: Zeichnen ist Denken mit dem Stift. Man beobachtet nicht nur, was man sieht, sondern auch sich selbst – das eigene Wollen, Sehnen, Denken.
Und wenn man die Zeichnung ernst nimmt, fragt man sich: Was will sie von mir? Was fordert sie? So entsteht eine Auseinandersetzung, die weit über das Handwerk hinausgeht.
Powerhouse: An der Oldenburger Kunstschule gibt es keinen Stillstand, ständig arbeitet das kleine Team an neuen Ideen und Formaten. (Bilder: Kulturschnack)
Können die Jugendlichen eigentlich eigene Ideen einbringen?
Das ist sogar unsere Grundhaltung: Wenn ein Kind oder Jugendlicher eine Idee hat, ist es unsere Aufgabe, diese Initiative zu unterstützen. Wir verstehen uns als Begleiter der Projekte der Kinder. Natürlich gibt es thematische Rahmen, aber innerhalb dessen haben sie viele Freiheiten.
Erlebst du oft, dass die Kinder und Jugendlichen von sich selbst überrascht sind?
Permanent. Das ist eigentlich das Ziel unserer Arbeit.
Wenn Kinder merken, dass etwas entstanden ist, das nur sie selbst schaffen konnten – dann ist das eine umwerfende Erfahrung. Diese Erkenntnis, selbst die Ursache zu sein, ist unglaublich kraftvoll.
Ihr arbeitet mit professionellen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die oft auch aus anderen Teilen Deutschlands stammen.
Genau. In einer Großstadt gäbe es vielleicht genug lokale Künstler, um so etwas allein zu stemmen, aber in Oldenburg holen wir uns gezielt Leute von außen dazu. Das bereichert enorm. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel eine Künstlerin dabei, die transidentisch ist. Das war auf mehreren Ebenen spannend – künstlerisch, aber auch menschlich. Solche Begegnungen erweitern den Horizont, auch für die Jugendlichen.
Große Vielfalt: Die Herangehensweisen, mit denen die Teilenehmenden das Thema umsetzten, unterschieden sich deutlich voeinander. (Bilder: Izabela Mittwollen)
Das klingt insgesamt nach einer sehr inspirierenden Erfahrung. Wie wird man denn Teil des Festivals?
Wir arbeiten mit vielen Schulen zusammen und fragen dort gezielt an. Lehrkräfte koordinieren das, und die Jugendlichen entscheiden natürlich selbst, ob sie teilnehmen möchten. Sie werden dafür vom Unterricht befreit – das muss also gut organisiert werden. Wer nicht möchte, muss natürlich nicht teilnehmen.
Was erhaltet ihr denn für Rückmeldungen von den Teilnehmenden?
Meist sehr positiv. Viele sagen, sie hätten sich Schule immer so gewünscht – lebendig, forschend, intrinsisch motiviert. Natürlich gibt es auch Jugendliche, die danach sagen: „Das war ganz schön intensiv, jetzt reicht’s auch erst mal.“ Aber genau das zeigt ja, wie tief die Erfahrung war.
Wie kann die Oldenburger Öffentlichkeit das Festival erleben?
Wir versuchen, immer auch Arbeiten im öffentlichen Raum zu zeigen. Dieses Jahr ist uns das wieder gelungen: Die schwäbische Künstlerin Janina Schmid hat eine Installation aus dünnem Stahlgestänge im Schlossgarten geschaffen – die steht immer noch dort. In manchen Jahren haben wir auch Litfaßsäulen beklebt, zum Beispiel 2023 zum Thema „Anderssein“. Künftig wollen wir sogar eine eigene Litfaßsäule dauerhaft bespielen, um Kunst junger Menschen ständig im Stadtraum sichtbar zu machen.
Starke Resonanz: Zur Ausstellungseröffnung des 10. Oldenburger Zeichenfestivals kamen neben Bürgermeisterin Petra Averbeck und Kulturdezernent Holger Denckmann auch viele Interessierte. (Bilder: Izabela Mittwollen)
Das alles klingt nach viel Arbeit, aber auch nach viel Begeisterung.
Absolut. Es ist intensiv, aber auch beglückend. Wir haben eine solide Förderung, die uns ermöglicht, viele Angebote kostenlos anzubieten. Das ist wichtig – damit Kunst allen offensteht. Und wir merken, wie stark das wirkt.
Dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg – und sind gespannt auf das nächste Festival.
Danke. Wir freuen uns schon sehr auf das, was kommt.
Tatsächlich ein Festival
Zugegeben: Wir haben uns ein wenig schwer getan, den Begriff „Festival“ mit der stillen Arbeit des Zeichnens in Einklang zu bringen. Zunähcst scheinen diese beiden Welten nicht zusammenzupassen. Aber wenn man Georg über das Ereignis sprechen hört - darüber, wie frei die Jugendlichen plötzlich agieren, wie sie alles andere um sich herum vergessen und am Ende von ihren eigenen Fähigkeiten überrascht werden - ergibt alles einen Sinn. Denn mir einem „Workshop“, einem „Kurs“ oder einem „Projekt“ wären das spannende Format einfach nicht ausreichend beschrieben. In der Art und Weise, wie es die jungen Teilnehmenden mitnimmt - oder besser gesagt: mitreißt - hat es eindeutig einen Festivalcharakter.
Ganz ausführlich: Im November 2022 haben wir uns in unserem Podcast ausführlich mit Annekathrin Scheer, Deliane Rohlfs und Georg Lisek über die Arbeit der Oldenburger Kunstschule unterhalten. Hört unbedingt mal rein! (Bild: Kulturschnack)
Aber lassen wir die Begrifflichkeiten mal kurz beseite. Am meisten zählt natürlich, was beim Oldenburger Zeichenfestival tatsächlich passiert. Und auch in dieser Hinsicht hallen Georgs Worte noch lange in unseren Ohren nach. Sebst wenn man das Alter der Zielgruppe längst hinter sich gelassen hat, ertappt man sich bei dem Gedanken: Da wäre ich gern dabei gewesen! Beim Zeichenfestival wird eben nicht nur gezeichnet – es wird gedacht, geforscht, reflektiert. Kein Wunder, dass viele Teilnehmende sich wünschen, dass Schule immer so inspirierend sein könnte.
Beim Zeichenfestival lernt man nicht nur Handwerkliches, sondern auch vieles über sich selbst und seine Sicht auf die Dinge. „Denken mit dem Stift“ - das ist mehr als eine knackige Überschrift, das ist eine gute Beschreibung dessen, was beim Festival passiert. Und der Rest der Stadt? Hat dank der öffentlichkeitswirksamen Aktionen im Stadtraum und der Ausstellungen im Core auch etwas davon und kann auf diese Weise selbst einmal den jungen Menschen „in die Köpfe schauen“. Das Oldenburger Zeichenfestival mag sich also von vielen Namensvettern deutlich unterscheiden. Gemeinsam hat es mit ihnen aber die hohe Bedeutung für den Standort, die enorme Attraktivität für die Zielgruppe und: ein wenig Magie.